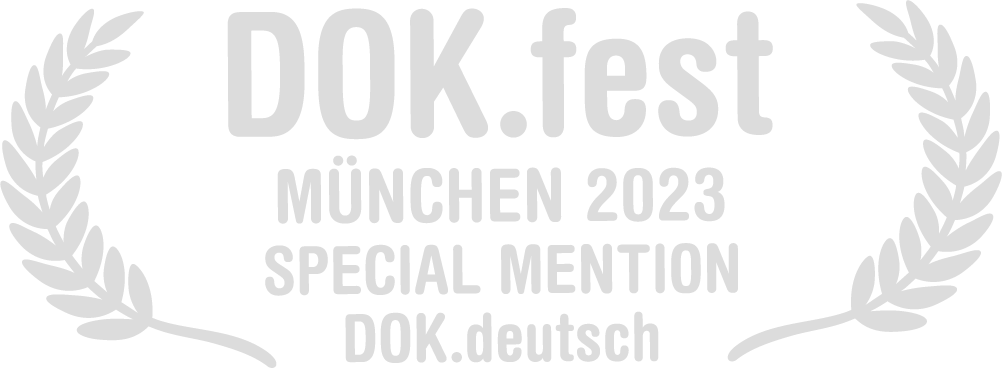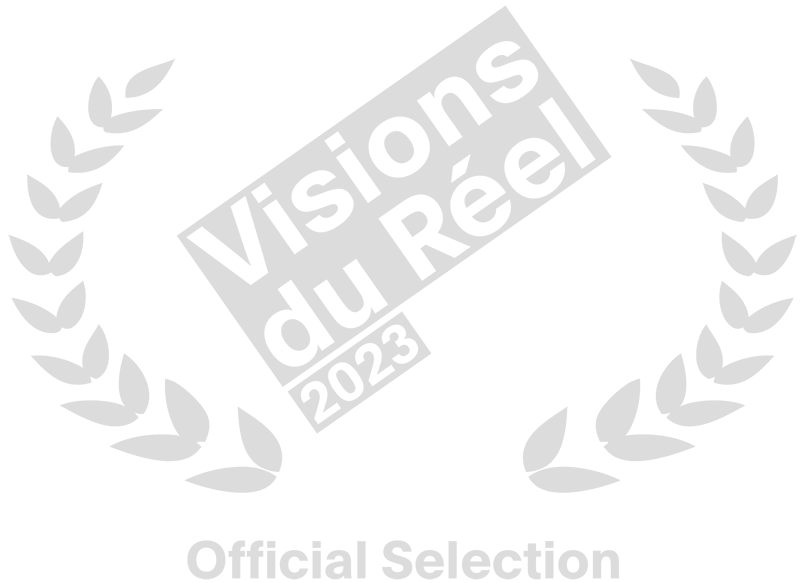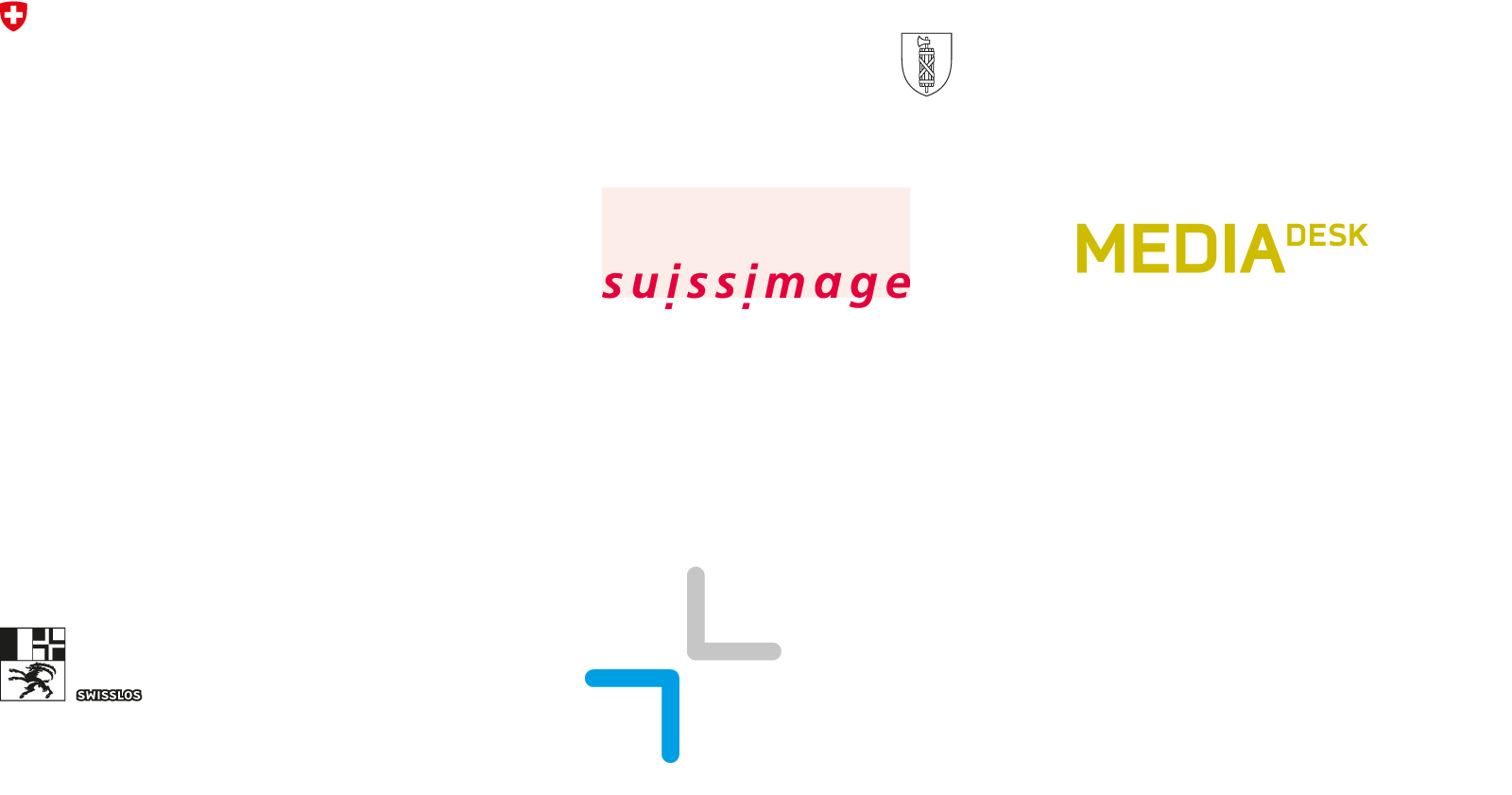Die Jenischen sind eine Gruppe von Menschen mit eigener Sprache, Kultur und Geschichte. Sie sind Angehörige oder Nachfahren einer Bevölkerungsgruppe mit traditionell reisender, in der Mehrzahl wohl semi-nomadischer Lebensweise. Sie leben hauptsächlich in der Schweiz, in Deutschland, Frankreich und Österreich, aber auch in anderen Weltgegenden. Ihre Gesamtzahl wird auf mehrere Hunderttausend geschätzt, allein in der Schweiz sind es rund 35‘000. Die französische Schreibweise ist Yéniche, die englische Yenish; sie werden teilweise bis heute Gens de Voyage oder Traveler genannt. In Österreich nennt man die Jenischen auch Karrner, Dörcher oder Laninger, in der Zentralschweiz Fecker, in der Ostschweiz Kessler oder Spengler. Jenisch ist die Selbstbezeichnung.
Die Sprache
Wesentliches gemeinsames Merkmal der Jenischen ist die Sprache. Linguistisch handelt es sich um ein Idiom, dessen Struktur auf der Sprache der Mehrheitsgesellschaft beruht, mit Wörtern aus dem Romanés, Jiddischen und aus romanischen Sprachen. Grosse Teile der Wörter entstanden aus einem kreativen Spiel mit Wörtern der umgebenden Sprache. Das jenische Wortgut fand teilweise Eingang in Dialekte und sogar in die Standardsprachen. Häufig wird Jenisch mit Rotwelsch verglichen oder gleichgesetzt, wobei Rotwelsch vermutlich nur eine behördliche «Erfindung» ist und nie als Sprache existierte. Seit 1997 wird das Jenische in der Schweiz als territorial nicht gebundene Sprache geschützt und gefördert.
Berufe
Von vielen Jenischen betriebene Berufe sind traditionellerweise der Wander- und Hausierhandel, der Schrott- und der Antiquitätenhandel, Recycling allgemein, das Korbergewerbe, das Richten von Herdplatten und Pfannen oder die Messer- und Scherenschleiferei und das Musikantengewerbe. Unterdessen finden sich aber in allen Berufen jenische Menschen.
Reisende Lebensweise
Ein wichtiger Bestandteil der Jenischen Kultur ist die reisende Lebensweise. Dabei ist das Thema vielschichtig und umstritten. Die Geschichte der Fahrenden ist seit Beginn eine Geschichte der Ausgrenzung. Im späten Mittelalter wurden die Nichtsesshaften von der Aristokratie ausgegrenzt. Diese bekämpfte den Nomadismus, weil ihr die Unkontrollierbarkeit ein Dorn im Auge war – die Nomaden galten als besonders freiheitsliebend.
Aufschlussreich ist das Schicksal der Jenischen in der Schweiz. Im 18. Jahrhundert wurden die Nichtsesshaften in «Gaunerlisten» erfasst. Im 19. Jahrhundert, im Zuge der Gründung der Nationalstaaten und den damit verbundenen Grenzziehungen, war in der Schweiz die Niederlassung neu unabdingbar an den Besitz eines Heimatscheines geknüpft, womit die behördliche Kriminalisierung der nicht sesshaften Lebensweise Einzug hielt: Die Kantone stellten neuerdings Polizeikorps auf, deren Hauptaufgabe die Abwehr «fremden Bettelgesindels» war. Während sich in der Schweiz von Kanton zu Kanton die Rechtsprechung änderte, wurden bei «Betteljagden» die Heimatlosen von Landjägern aufgegriffen und über die Kantonsgrenzen gestellt. Es gab aber auch viele sesshafte Jenische, deren Heimatbescheinigung von ihren Gemeinden nicht erneuert wurde und die als Folge dessen zu Fahrenden wurden. Andere wiederum wurden unter dem gesellschaftlichen Druck sesshaft, so auch Familien von bekannten Musikanten wie die Wasers und Kolleggers. Zweischneidig war 1851 im jungen Schweizer Bundesstaat das Gesetz gegen die Heimatlosigkeit. Alle Jenischen erhielten zwar das Schweizer Bürgerrecht, sie wurden aber auch zwangsweise einem Bürgerort zugewiesen, und die reisende Lebensweise wurde unter Strafe gestellt. Es handelte sich also auch um eine Umerziehungs- und Disziplinierungsmassnahme. Viele machten sich sesshaft, um nicht aufzufallen und ihre Tätigkeiten weiter ausüben zu können. Oft erforderten die Tätigkeiten aber wiederum, reisend unterwegs zu sein. So wurden viele Jenische gezwungen, sich in einer Grauzone am Rande der Legalität zu bewegen.

Verfolgung und Diskriminierung
Im 20. Jahrhundert nahmen Ausgrenzung, Diskriminierung und Verfolgung zu. In der Schweiz wurden jenische Familien ab den 1920er Jahren bis in die frühen 1970er Jahre vom «Hilfswerk Kinder der Landstrasse» , das zur Stiftung Pro Juventute gehörte, verfolgt. Das von Dr. Alfred Siegfried geleitete «Hilfswerk» verfolgte das Ziel, jenische Kinder von ihrer Herkunft abzuschneiden. Mit Billigung des Staates wurden über 600 Kinder ihren Familien entrissen und in Heimen oder Pflegefamilien untergebracht. Alles Jenische sollte getilgt werden. Geschwister wurden voneinander getrennt in Heime gegeben oder in fremde Familien platziert, Jugendliche in Anstalten gesperrt. Es sind Vergewaltigungen, Zwangsweinweisungen in die Psychiatrie und Sterilisierungen dokumentiert. Ganze Familien, von den Grosseltern bis zu den heutigen Nachfahren, wurden traumatisiert. Fast jede jenische Familie weiss von Kindswegnahmen zu berichten. 1972 berichtete der Journalist Hans Caprez im «Schweizerischen Beobachter» über die Kindswegnahmen und das menschenverachtende Vorgehen des «Hilfswerks». Öffentlicher Druck veranlasste die Pro Juventute in der Folge, das «Hilfswerk» im Frühjahr 1973 aufzulösen. Eine strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen des Projekts gab es nicht.
Viel zu wenig im kollektiven Bewusstsein verankert sind die Verfolgungen der Jenischen im Holocaust. Sie wurden wie die Juden, Sinti und Roma verfolgt und in Konzentrationslager verschleppt, in Todeslagern umgebracht. Es sind Bestrebungen im Gang, eine diesbezügliche Erinnerungskultur zu etablieren.
Kampf um Anerkennung, Vereine und Organisationen
Als Folge der Aufdeckung der vom «Hilfswerk Kinder der Landstrasse» begangenen Verbrechen formierte sich in der Schweiz die jenische Organisation «Radgenossenschaft der Landstrasse», die in der Aufarbeitung eine wichtige Rolle spielte. Als ihr Sprachrohr trat die kürzlich verstorbene Schriftstellerin und Jenische Mariella Mehr auf, die wortgewaltig an die Behörden trat und Entschuldigung und Wiedergutmachung einforderte. Die «Radgenossenschaft der Landstrasse» gibt eine eigene Zeitschrift, das «Scharotl», heraus.
Weitere Organisationen treten an die Öffentlichkeit und engagieren sich für die Anerkennung der Jenischen als Volk mit den Rechten einer ethnischen, kulturellen und sprachlichen Minderheit. In der Deutschschweiz sind das die Stiftung «Naschet Jenische», das «Fahrende Zigeuner-Kulturzentrum» und der «Verein Bewegung der Schweizer Reisenden (BSR-MVS)», in der Romandie die «Association Jenisch-Manouches-Sinti (JMS)», die «Association Yenisch Suisse» und die «Citoyens Nomades». Albert Barras tritt als Pressesprecher des fahrenden Volks für die Romandie auf. Und May Bittel ist schon lange als Experte für das Fahrende Volk im Europarat vertreten. In der Schweiz sind die Jenischen seit 1997, respektive 2016 als nationale Minderheit anerkannt.
Mit Verweis auf die Schweiz kämpfen auch die Jenischen in Deutschland und Österreich für ihre Anerkennung. Im 21. Jahrhundert sind verschiedene Organisationen der Jenischen entstanden, so der «Zentralrat der Jenischen Deutschlands», der «Verein der Jenischen in Singen», «Der Jenische Kulturverband» und der «Verein zur Anerkennung der Jenischen in Österreich und Europa». In Österreich war Romed Mungenast ein wichtiger Pionier. Der jenische Verein «schäft qwant» agiert als transnationaler Verein für jenische Zusammenarbeit und Kulturaustausch. Im Tirol setzt sich der Verein «Initiative Minderheiten Tirol» auch für die Sichtbarmachung der jenischen Kultur und Lebensweise ein.
Jenische, Sinti und Roma
Die Jenischen, Sinti und Roma werden oft in einem Atemzug genannt, ihre Kulturen unterscheiden sich jedoch klar. Der Ursprung der Sinti und Roma wird in Nordindien beziehungsweise dem heutigen Pakistan vermutet. Ihre Sprachen, das Romanes und das Manische, entstammen dem altindischen Sanskrit. Die Jenischen hingegen sind Hiesige: die jenischen Familien in der Schweiz sind in der Regel schweizerischen Urspungs, jenische Familien in Deutschland stammen aus deutschen Gegenden etc. Die Sinti sind nach dem Mittelalter nach Europa gelangt, wo sie mit den Jenischen in Kontakt kamen. Nicht selten haben sich Jenische und Sinti-Familien verbunden. Der Überbegriff «Fahrende» für Jenische, Sinti und Roma wurde eingeführt, um das von vielen als diskriminierend empfundene Wort «Zigeuner» zu ersetzen (wobei viele Jenische das Wort «Zigeuner» auch als Selbstbezeichnung verwenden). Der Begriff «Fahrende» ist allerdings irreführend, da der Grossteil sesshaft ist. Es ist deshalb sinnvoll und entspricht den Vorgaben des europäischen Minderheitenschutz-Abkommens, die verschiedenen ethnischen Gruppen so zu bezeichnen, wie sie sich selber nennen: als Jenische, Sinti und Roma.
Zusammengestellt und zitiert aus thata.ch, jenisch.info, einem Artikel-Ausschnitt von Stefan Künzli «Jenische in der Schweiz», Brigitte Baur «Erzählen vor Gericht» und de.wikipedia. org/wiki/Jenische.